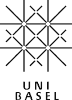
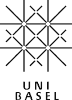 |
||
|
• Stellungnahmen • Zurück zu 10 Jahre OE-Studien
|
Stellungnahmen
· Argumente · Informationen (zurück zur Übersicht)
Platons Dialog Ion und das Slavische Seminar der Universität Basel (eine mögliche Betrachtung aus literaturwissenschaftlicher Sicht)
Dem heutigen Literatur- und Sprachwissenschaftler klingt die Sokratische Argumentation nur allzu vertraut in den Ohren und am liebsten möchte er sich Goethe und dessen Verteidigungsschrift anschließen: Ein Wagenlenker, hatte Goethe eingewandt, wisse bloß, ob Homer „richtig“, nicht aber, ob er „gehörig“ spreche, da hierfür nur „Anschauen und Gefühl und nicht eigentlich Kenntnis“ benötigt würden, auch wenn Fachkenntnisse keineswegs schadeten. Dichtung verlange einen anderen Maßstab. Doch was haben Ion und Goethe mit der Einschätzung heutiger Philologien zu tun? Eines ist unbezweifelt: Ion zeigt uns, dass wir in den letzten zweieinhalbtausend Jahren, zumindest in der Beurteilung der Dichtung und ihrer Auslegung, keinen Deut weiter gekommen sind. Noch immer widersprechen die Dichtung und ihre Institutionen dem Prinzip der Nützlichkeit oder wie man heute sagen würde: der Nachhaltigkeit, der Relevanz, der Marktführerschaft. Noch immer scheint das, was Platon „Inspiration“ nennt und was er von der menschlichen Vernunft trennen möchte, ein elementarer Bestandteil des Menschen zu sein. Noch immer kleben sich – um im Bild Platons zu bleiben –, Tausende wie Eisenteile an die magnetische Kraft gedichteter Werke. Als Literaturwissenschaftler möchte man sich also am liebsten Goethe anschließen: Dichtung ist ein menschliches Bedürfnis, das sich anders als die Naturwissenschaften legitimiert – vielleicht der Religion ähnlich oder dem Spaziergang im Stadtpark – und sie braucht ihre Einrichtungen und Orte wie die Religion und der Spaziergang. Hört man von der drohenden Schließung des Slavischen Seminars in Basel, möchte man freilich wie Ion argumentieren: Hier wird ein Fachwissen gelehrt, das auf nicht weniger als einen Drittel der europäischen Bevölkerung zielt – auf Länder, die sich seltsamerweise gerade jetzt mit dem wichtigsten Handelspartner der Schweiz zusammenzuschließen beginnen, zu einem Zeitpunkt also, da ihre Sprachen als nicht mehr relevant gelten sollen. Kann denn in Frage gestellt werden, dass Sprachkenntnisse im Kontakt mit andern Staaten die Einschätzungsfähigkeit auch politischer Konstellationen, Wirtschaftsstrukturen und Handelspartner nicht massiv erhöhen? Ist die Vermittlung der slavischen (und anderer) Sprachen und Kulturen an Universitäten nicht unabdingbarer Bestandteil einer gleichberechtigten Kommunikation, die Voraussetzung einer stabilen Gesellschaft ist? Braucht nicht auch Europa die Finanzierung eines Austauschs auf muttersprachlicher Basis wie die deutschsprachige Schweiz den Unterricht in Französisch braucht, um als Staat überleben zu können? Als Literaturwissenschaftler möchte man freilich
lieber anders argumentieren: Die Schweiz ist, wie jedes andere Land, ohne
die slavischen Literaturen – wenn nicht an Haus und Hof –
so doch ärmer. Robert Hodel, Hamburg
Stellungnahmen · Argumente · Informationen (zurück zur Übersicht) |